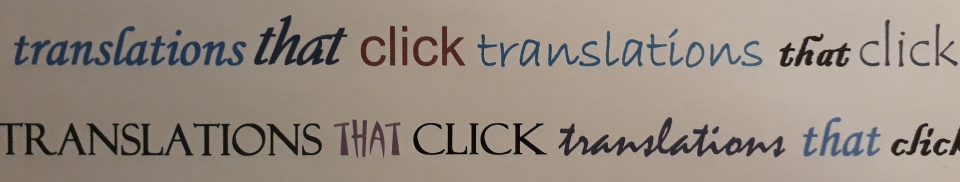
Sometimes the two languages just refuse to mean the same thing.
Lore Segal
Luckily, this isn't always the case.
Ursula C. Sturm
Leseprobe
aus: Die dünne
Schicht Geborgenheit von Lore Segal (Picus, 2004)
Die Umkehrwanze
„Fangen wir mit den Ankündigungen an“, sagte Ilka, die „Conversational English“ für Erwachsene unterrichtete, zu ihren Ausländern. „Morgen Abend findet am Institut ein Symposium statt. Achmed“, sie
wandte sich an den Türken in ihrem Kurs, der einen üppigen Schnurrbart im Gesicht und in seiner Funktion als Hausmeister sämtliche Institutsschlüssel am Gürtel trug, „wo findet das Symposium
statt?“
„Im neuen Auditorium.“
„Das Thema lautet: Soll eine Verjährungsfrist für Völkermord eingeführt werden? Es wird einen Empfang geben, mit Käse und Wein - “
„Und zwar im Foyer“, sagte Achmed.
„Zu dem ihr alle eingeladen seid. So“, Ilka sprach mit der munteren Stimme einer Gastgeberin, die versucht, eine schleppende Dinnerparty in Gang zu bringen, „worüber sollen wir heute reden? Ich weiß,
es nützt nichts, wenn ich euch bitte, alle nach vorn zu kommen und ein bisschen zusammenzurücken. Wer möchte denn anfangen? Wer erzählt uns eine Geschichte? Wir alle lieben Geschichten. Erzählt, wie
ihr nach Amerika gekommen seid.“
Die Lehrerin übersah geflissentlich die Hand, den Arm, mit dem Gerti Grüner die Luft umrührte. Tod, Steuern und Donnerstage, mit Gerti Grüner in der ersten Reihe. Ilkas Blick streifte Paulino in der
hintersten Bank, mit dem Rücken an die Wand. Matsue, ein liebenswürdiger, älterer Japaner, der dem technischen Institut der Universität angehörte, lächelte Ilka an und schüttelte den Kopf, was soviel
hieß wie „Mich bitte nicht“. Matsue saß auf seinem angestammten Platz am Fenster, doch was Izmira, den zypriotischen Arzt betraf, der stets zwei Reihen Abstand zwischen sich und Achmed, dem Türken
freiließ, musste Ilka sich heute umorientieren. Heute saß Juan, der Baske ganz rechts in der Ecke, und Eduardo, der Spanier aus Madrid, ganz links.
Ilka hielt Ausschau nach einem Kursteilnehmer, der vielleicht gerne etwas sagen würde, falls er aufgerufen wurde, aber zu schüchtern war, um sich zu Wort zu melden. Doch Gertis Hand durchbohrte die
Luft unmittelbar unter Ilkas Kinn, also sagte sie: „Gerti möchte anfangen. Also los, Gerti. Wann bist du in die U.S.A. gekommen?“
„Vorigen Juni.“
„Erzähl den anderen, woher du gekommen bist, und sprecht bitte alle in ganzen Sätzen.“
„Davor hab ich in Uruguay gelebt, und davor in Wien.“
Gertis Geschichte hatte große Ähnlichkeit mit Ilkas eigener, unverdaubarer Geschichte der Vertreibung aus Hitlers Europa als kleines Mädchen.
Gerti sagte: „Auf dem Bahnhof in Wien hat mein Vater zu mir gesagt, sobald ich nach Montevideo komme, soll ich allen Leuten sagen, sie sollen meinen Vater aus Wien herausholen bevor die Nazis kommen
und ihn ins Konzentrationslager stecken. Und auch meine Mutter, und meinen Opa, und meine Oma, und meinen Onkel Peter, und die Zwillinge Hedi und Albert. Mein Vater hat mir aufgetragen, ich soll
meine Pflegemutter bitten, dass sie mit mir zum amerikanischen Konsulat geht.“
„Mein Vater ging zum amerikanischen Konsulat“, sagte Paulino, und alle wandten den Kopf und sahen ihn an. Sie hatten Paulinos Stimme nicht mehr gehört, seit Ilka sie am ersten Donnerstag
aufgefordert hatte, sich gegenseitig vorzustellen. Paulino hatte gesagt, sein Name sei Paulino Patillo und er sei in Bolivien zur Welt gekommen. Ilka stellte bezaubert fest, dass er sie an Danny Kaye
erinnerte – blond, lockig, lächelnd, mittleren Alters. Er erschien pünktlich jeden Donnerstag. War er ein sehr liebenswürdiger Mensch, oder ein sehr einfältiger?
Ilka sagte: „Paulino erzählt uns seine Geschichte, wenn Gerti mit ihrer fertig ist. Wie alt warst du, als du aus Europa geflüchtet bist?“ fragte sie, um Gerti zu reaktivieren, die zurückgab: „Acht“,
dabei jedoch wie alle anderen, Ilka eingeschlossen, beobachtete, wie Paulino die rechte Hand in die linke Brusttasche seiner Jacke gleiten ließ, ein Kuvert hervorholte, auf den Kopf stellte und ein
Häufchen Zeitungsausschnitte auf den Tisch vor sich kippte. Manche sahen neu aus, wie frisch ausgeschnitten, andere vergilbt und brüchig; einige bestanden offenbar nur aus einem einzigen Absatz,
andere dagegen aus mehreren Spalten.
Ilka half Gerti auf die Sprünge: „Du bist also nach Montevideo gekommen …“
„Und die Pflegemutter hat mich am Hafen abgeholt. Ich hab gesagt: ‚Hallo, holen S' bitte meinen Vater aus Wien heraus, bevor die Nazis kommen und ihn in ein Konzentrationslager stecken!’“ sagte
Gerti.
Paulino hielt das Kuvert dicht vor seine Augen und spähte hinein. Er löste mit dem Zeigefinger etwas, das darin feststeckte und schüttelte einen letzten Zeitungsausschnitt heraus. Als Paulino ihn auf
dem Tisch glatt strich, riss er am Falz auseinander. Paulino fegte ein paar Papierkrümel weg, ehe er vorzulesen begann: „La Paz, 19. September.“
„Paulino“, sagte Ilka, „Du musst warten, bis Gerti fertig erzählt hat.“
Doch Paulino las: „Claudio Patillo wurde nach einem Besuch beim amerikanischen Konsulat in La Paz am 15. September von seiner Gattin Señora Pilar Patillo als vermisst gemeldet.“
„Gerti, erzähl weiter“, sagte Ilka.
„Die Pflegemutter hat gesagt: ‚Wenn der Onkel aus dem Büro heimkommt, werden wir ihn fragen’. Ich hab gesagt: ‚Und bitte holen S' auch meine Mutter, meinen Opa, meine Oma, meinen Onkel Peter
…’“
Paulino las: „Ein Sprecher des amerikanischen Konsulats in La Paz gibt ausdrücklich an, in den vergangenen zwei Monaten habe Señor Patillo dort nicht vorgesprochen.“
„Paulino, du musst warten, bis du dran bist!“ sagte Ilka.
Gerti sagte: „‚Und die Zwillinge auch.’ Die Pflegemutter hat ein verzweifeltes Gesicht gemacht, mit ihren Lippen.“
Paulino las: „Wie aus dem Konsulatskalender hervorgeht, war im Monat September kein Termin mit Señor Patillo eingetragen. Die Nachforschungen im Konsulat von Sucre sind noch im Gange.“ Damit faltete
Paulino den Zeitungsartikel zusammen und steckte ihn zurück in das Kuvert.
„O. k., danke, Paulino“, sagte Ilka.
Gerti fuhr fort: „Als der Pflegevater nach Hause gekommen ist, hat er gesagt: ‚Schauen wir einmal, morgen.’ Und ich habe gesagt: ‚Gehen S' bitte mit mir zum amerikanischen Konsulat’, und da hat er
ein langes Gesicht gemacht.“
Paulino strich den zweiten Zeitungsausschnitt auf dem Tisch glatt und begann erneut zu lesen: „New York, 12. Dezember …“
„Paulino“, sagte Ilka und bemerkte, dass Matsue sie eindringlich ansah. Er schüttelte kaum merklich den Kopf und klopfte mit der flachen rechten Hand, die Handfläche nach unten, drei mal
leicht die Luft. In der verständlichen Zeichensprache, mit der die Menschheit Gott schon beim Turmbau von Babel überlistet hat, bedeutete er ihr damit: „Ganz ruhig, Ilka. Lass Paulino fertig lesen.
Du kannst ihn ohnehin nicht davon abbringen.“ Ilka war Matsue dankbar.
„Ein Sprecher der Israelischen Mission der Vereinten Nationen“, las Paulino vor, „bestreitet, dass sich Claudio Patillo, der seit einem Besuch im amerikanischen Konsulat in La Paz am 15. September
vermisst wird, auf dem Weg nach Israel befindet …“ Paulino las auch diesen Artikel zu Ende, faltete ihn zusammen, steckte ihn wieder in das Kuvert und faltete den nächsten auseinander. „United Press
International, 30. Januar. Auf dem Grund einer Schlucht in den Ost-Anden wurde das Fahrzeug von Pilar Patillo, der Gattin des seit vergangenen September in La Paz als vermisst gemeldeten Claudio
Patillo, entdeckt. Es ist nicht bekannt, ob sich jemand in dem Wrack befand.“ Paulino las mit der blinden Unbeirrbarkeit eines Panzers, in den keinerlei Botschaften, weder Geräusche noch Bewegungen,
von der Außenwelt eindringen können. Die anderen Kursteilnehmer sahen ihn nicht mehr an, sie sahen die Lehrerin nicht an. Sie schauten in ihren Schoß. Paulino las einen Zeitungsartikel nach dem
anderen, steckte jeden ordentlich in das Kuvert zurück, ehe er zum nächsten überging, und nachdem er den letzten gelesen und zurückgesteckt und das Kuvert wieder in seiner Brusttasche verstaut hatte,
lehnte er sich mit dem Rücken an die Wand und wandte sich der Lehrerin zu, freundlich lächelnd und erwartungsvoll interessiert wie immer.
Gerti sagte: „In derselben Nacht bin ich aufgewacht …“
Die Lehrerin sah sie hilflos an.
„… und habe mir gedacht: ‚Und wenn gerade jetzt, in dieser Minute, ein Nazi an die Tür klopft, und ich liege da und sage niemandem etwas?’ Da bin ich aufgestanden und in das Schlafzimmer gegangen, wo
die Pflegeeltern geschlafen haben. Am nächsten Tag ist die Pflegemutter mit mir zum Flüchtlingskomitee gegangen und hat mir eine andere Pflegefamilie gesucht.“
„Du bist dran, Matsue“, sagte Ilka. „Wie, wann und warum bist du in die Staaten gekommen? Wir alle werden dir helfen.“
Matsues schriftliches Englisch war perfekt, aber er sprach mit einem nahezu undurchdringlichen Akzent. Seine Gesprächsbeiträge in der Stunde erforderten immer einen gemeinsamen Interpretationsakt.
„Ichaa habaa inna Munhenaa anda Unibasitäta studiertaa“, sagte Matsue.
Nach ein paar Versuchen hatte Eduardo, der Madrileño, es erraten: „Du hast in München an der Universität studiert!“
„Du hast Akustik studiert?“ riet Izmira, der zypriotische Arzt.
„Du konntest wegen dem Krieg nicht mehr aus Deutschland weg?“ schlug Ahmed, der Türke vor.
„Du hast in den Öfen gearbeitet?“ fragte Gerti, die Wienerin.
„Akustische Öfen?“ rätselte Ilka. „Meinst du Küchenherde? Gasherde?“
Nein, Matsue meinte damit, er habe seine erste Stelle bei einer Münchener Firma erhalten, die damit beauftragt war, die Gaskammern in Dachau schalldicht zu machen, damit das, was darin vorging, nicht
nach draußen dringen konnte. „Ichaa habaa dia Kassettenna gemachta“, sagte Matsue. „Was für Kassetten?“ wollten die anderen wissen. Es stellte sich heraus, dass Matsue 1946 nach Japan zurückgekehrt
war und „Kassetten“ von Hiroshima gesammelt hatte. Er war als Tontechniker für das Kennedy Center nach Washington berufen worden und hatte dann den Auftrag erhalten, das neue Auditorium an der
Universität von Concordance, Connecticut, mit einem Soundsystem auszustatten. Danach hatte er hier am technischen Institut der Universität einen Forschungsauftrag angenommen. Jetzt war er im Begriff,
nach Japan zurückzukehren, da seine Arbeit hier beendet war – ein Projekt, bei dem es um Umkehrwanzen ging, wenn Ilka sich nicht verhört hatte.
Ilka lachte: „Haha, ich habe gerade ‚Umkehrwanzen’ verstanden!“
Genau das habe er auch gesagt, so Matsue, für alle hörbar: „Umkehrwanzen“. Er beschrieb mit der Hand eine Reihe von Kringeln in der Luft und wies an die Wand hinter dem Lehrerpult, worauf er von Ilka
die Erlaubnis erhielt, sich schriftlich an der Tafel zu erklären.
Mit der Kreide in der Hand erläuterte er sodann wortgewandt das Prinzip der herkömmlichen Wanze, die in einem Raum installiert werden kann, um gegen den Willen der dort befindlichen Personen
Informationen von drinnen nach draußen zu übertragen. Eine technisch hochentwickelte moderne Wanze könne man übrigens weder lokalisieren noch deaktivieren. Ganze Gebäude hätten bereits
auseinandergenommen werden müssen, um sie von feindlichen Abhörgeräten zu befreien. Bei der Umkehrwanze handle es sich um ein Gerät, das man ebenso wenig lokalisieren oder deaktivieren könne, und mit
dessen Hilfe es möglich sei, Informationen von außen in einen Raum hinein zu übertragen, wiederum gegen den Willen der dort befindlichen Personen.
„Und wo käme ein derartiges Gerät zum Einsatz?“ fragte ihn Ilka.
Soweit die anderen das verstanden, gab Matsue zur Antwort, es könne sich unter gewissen Umständen für gewisse Konsulate als nützlich erweisen, worauf Paulino „Mein Vater ging zum amerikanischen
Konsulat“ sagte und in die Brusttasche seine Jacke griff. Da erhob sich Ilka und sagte, obwohl bis zum Ende der Stunde noch gute fünfzehn Minuten übrig waren: „Also dann bis nächsten Donnerstag.
Überlegt euch bitte Themen, über die wir reden können. Und denkt an das Symposium morgen Abend!“ Damit eilte sie aus der Klasse.
Ilka betrat das neue Auditorium mit Verspätung und war froh, dass in der zweitletzten Reihe neben Matsue, der am Mittelgang saß, noch ein Sessel frei war. Auf dem Podium nahmen eben die Redner Platz.
Rechts unterhielt sich ein überaus attraktiver, goldhäutiger Lateinamerikaner mit einem plumpen, zerknautschten Mann, der Ilka eindeutig israelisch vorkam. Es hatte den Anschein, als wären die beiden
alte Bekannte. „Siehst du den Dünnen da links?“, fragte sie Matsue. „Der ist mit Sicherheit aus Washington. Nur dort haben die Leute diese ganz eigene weiße Haarfarbe.“ Matsue lachte. Sie fragte ihn,
wer die Frau mit der Riesenbrille und dem glatten, schulterlangen weißen Haar wohl sein könne, verstand jedoch seine Antwort nicht. Die übrigen Diskussionsteilnehmer waren vom Institut, Ilkas
Kollegen: der kleine Joe Bernstine von der Philosophie, Yvette Gordot, die Mathematikerin, und Leslie Shakespere, der Direktor des Instituts, der als Moderator fungierte.
Leslie Shakespere hatte ein Genussbäuchlein und eine Denkerstirn. Es war Ilka noch nicht in den Sinn gekommen, dass sie in Leslie Shakespere verliebt war. Sie sah ihn am Mikrofon herumfummeln und las
die Worte „Wozu brauchen wir das überhaupt?“ von seinen Lippen. „Seit wann brauchen wir im neuen Auditorium Mikrofone?“ Er verschaffte sich Ruhe im Saal, indem er die Anwesenden begrüßte und ihnen
dafür dankte, dass sie sich eingefunden hatten, um eines der schier unlösbaren Probleme unserer Generation zu diskutieren – die Anwendung der Rechtssprechung in einem Zeitalter des
Völkermordes.
An dieser Stelle erhob sich Rabbi Shlomo Grossman aus der Masse des Publikums und nahm Anstoß an der Formulierung „Nicht jede Tötung ist Mord; nicht jeder Mord ist ‚Völkermord’“.
Leslie sagte: „Shlomo, könntest du dich mit deinen Bemerkungen bis zur allgemeinen Fragerunde zurückhalten?“
„Bemerkungen? Soll das etwa eine Bemerkung gewesen sein? Der Tod von sechs Millionen Menschen – bewegt sich der etwa im Bereich einer Frage?“
„Ich verspreche, du wirst ausreichend Gelegenheit haben, deine Ansichten mit uns zu teilen, sobald wir die Diskussion für das Publikum eröffnen.“ Rabbi Grossman beugte sich dem offensichtlichen
Wunsch seiner umsitzenden Freunde und nahm wieder Platz.
Leslie zählte in aller Kürze auf, welche staatlichen und privaten Mittel es dem Concordance Institute ermöglicht hatten, die anwesenden namhaften Persönlichkeiten für das Genozid-Projekt zu gewinnen.
„Wie Sie wissen, gibt es an unserem Institut seit langem die Tradition, in der Endphase eines jeden Projektes eine Art ‚Nachbesprechung’ abzuhalten, im Zuge derer die Beteiligten den Mitgliedern des
Instituts, der Universität und der Öffentlichkeit eine Zusammenfassung des Gesagten und Gedachten unterbreiten. In diesem Falle jedoch sind die Teilnehmer der heutigen Podiumsdiskussion
übereingekommen, probehalber bereits zu Anfang des Projektes in einem informellen Rahmen über ihre Vorstellungen zu sprechen und sich darüber auszutauschen, woraus sich das anfängliche Interesse
jedes einzelnen an dieser Frage – diesem Problem – ableitet. Ich möchte, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen, welche Art von Überlegungen wir hier eigentlich anstellen: Werden wir
uns nach Beendigung dieses Projektes in unseren Ansichten bestärkt sehen? Werden wir in unserer Haltung gemäßigter sein? Oder ganz anderer Meinung?
Es ist anzunehmen, dass sich unsere Überlegungen irgendwo zwischen zwei gegensätzlichen Konzepten bewegen werden: hier das gesetzliche Prinzip der Verjährung, das eine Zeitspanne festlegt, innerhalb
derer das von Menschenhand geschaffene Rechtssystem auf ein Verbrechen reagieren muss, dort das biblische Prinzip der Bestrafung nachfolgender Generationen für Sünden ihrer Väter. Das Thema wird etwa
in der Aischylos-Trilogie ‚Oresteia’ durchgespielt, in welcher der Held ein Verbrechen durch einen Akt sühnt, der ebenfalls ein Verbrechen und als solches strafbar ist – eine Handlungskette, die sich
über Generationen erstreckt. Genug gesagt. Ich möchte Ihnen nun die Damen und Herren unserer Diskussionsrunde vorstellen, deren Gesellschaft wir in den kommenden Monaten genießen dürfen.“
Der weißhaarige Herr entpuppte sich als Dieter Dobelmann, ehemaliger Bürgermeister der deutschen Stadt Obernpest. Ilka war prompt der Überzeugung, sie hätte es schon die ganze Zeit gewusst – man sah
es ihm doch schon von weitem an: dieser Mund, dieses Kiefer mussten einem Deutschen gehören. Leslie sprach ausführlich über Dobelmanns überzeugende anti-nationalsozialistische Referenzen. Die Frau
mit Brille war dem Institut leihweise von der Georgetown University zur Verfügung gestellt worden. („Siehst du! Die weißen Haare!“ flüsterte Ilka Matsue zu, der lachte). Sie hieß Shulamit Gershon,
stammte ursprünglich aus Jerusalem, war Professorin für Völkerrecht und seit langem als Beraterin für ein israelisches Projekt tätig, das nationalsozialistische Kriegsverbrecher identifizierte und
vor Gericht brachte. Der zerknautschte Mann war Paul Thayer, ein englischer Theologe. Der Lateinamerikaner stammte tatsächlich aus Lateinamerika: Sebastian Maderiaga, derzeit vom Dienst in seinem
Konsulat in New York freigestellt. Leslie spähte mit zusammengekniffenen Augen durch das Licht der Scheinwerfer ins Publikum hinunter. Es gab Unruhe im Saal, als einige Zuhörer sich umwandten, um die
Stimme zu lokalisieren, die gesagt hatte: „Mein Vater ging zum amerikanischen Konsulat“, da die Stimme jedoch nichts weiter sagte, lehnten sie sich wieder zurück. Leslie stellte Yvette und Joe vor,
die beiden für das Projekt Völkermord zuständigen Institutsmitglieder.
Ilka und Matsue beugten sich nach vorn und beobachteten Paulino, der auf der anderen Seite des Ganges eben seinen Umschlag aus der Brusttasche seiner Jacke hervorholte. „Ohne Tisch?“ flüsterte Ilka
gespannt. Paulino leerte den Inhalt des Umschlags auf seinen Schoß. Der junge Student neben ihm kniete sich nieder, um das von Paulinos Oberschenkeln rutschende Häufchen Zeitungsausschnitte
aufzuheben und hielt es, während Paulino sich den Mantel über die Beine legte, um eine ebene Fläche zu schaffen.
„Die Frage, die ich mir stelle“ sagte Leslie, „und die ich der Diskussionsrunde stellen möchte, lautet: Woher kommen meine Gefühle des moralischen Unbehagens, wenn Unrecht unbestraft bleibt und Recht
unbelohnt?“
Paulino hielt sich den ersten Zeitungsausschnitt dicht vor die Augen und las: „La Paz, 19. September. Claudio Patillo wurde nach einem Besuch beim amerikanischen Konsulat in La Paz am 15. September
von seiner Gattin Señora Pilar Patillo …“
„Warum“, sagte indes Leslie „erwartet sich der menschliche Verstand, dass es gewisse Konsequenzen geben müsse, wo es doch weder in der Natur noch in der Geschichte und schon gar nicht in der eigenen
Autobiografie auch nur den geringsten Beweis dafür gibt? … Darf ich unsere Zuhörer freundlichst um Ruhe bitten, bis wir die Diskussion für alle eröffnet haben?“ Leslie spähte erneut ins
Publikum hinunter.
Die Zuhörer wandten die Köpfe und sahen Paulino an, der las: „Wie aus dem Konsulatskalender hervorgeht, war im Monat September kein Termin …“ Shulamit Gershon beugte sich zu Leslie hinüber und
unterhielt sich kurz mit ihm, während Paulino fortfuhr: „Ein Sprecher der Israelischen Mission der Vereinten Nationen bestreitet, dass sich …“
Nach mehreren Versuchen, Paulino zum Schweigen zu bringen, sagte Leslie: „Ahmed? Ist Ahmed im Saal? Ahmed, sei doch bitte so freundlich und bring den Störenfried so friedlich wie möglich hinaus. Führ
ihn bitte in mein Büro, und nach dem Symposium werde ich mich zu ihm gesellen.“
Alles sah zu, wie Ahmed in Begleitung eines großen, verlegen aussehenden Studenten den Mittelgang entlang ging. Die beiden griffen den widerstandslosen Paulino unter den Achseln, hoben ihn aus dem
Sessel und trugen ihn rücklings zur Tür hinaus, während Paulino las: „…wurde das Fahrzeug von Pilar Patillo, der Gattin des seit vergangenen September in La Paz als vermisst gemeldeten …“
Das Ganze hatte etwas von einer klassischen Comedy-Nummer. Es war ein Gackern zu hören, dann ein allgemeines, befreites Gelächter. Leslie lehnte sich erleichtert zurück. Ihm war klar, dass es einige
Zeit dauern würde, bis der Abend wieder in gewohnten Bahnen verlaufen konnte. Aber das Gackern hörte nicht auf. Leslie sagte: „Bitte.“ Er wartete. Er legte den Kopf schief und lauschte: Es hörte sich
eher wie ein Schluckauf an, der sich zu einem langgezogenen, von einem einzigen Atemzug gespeisten Laut ausdehnte. Leslie schaute zur Diskussionsrunde hinüber. Die Leute in der Diskussionsrunde
schauten um sich. Das Publikum schaute rechts und links. Leslie neigte den Kopf und legte das Ohr ans Mikrophon. Es nützte überhaupt nichts, dass er es aus- und wieder einschaltete, die Hand über die
Kapsel legte, sich darüber beugte, als würde er ihm ins Auge sehen. „Weiß irgendjemand – wird der Ton hier drin zentral reguliert?“ Der Lärm nahm langsam aber sicher zu. Die Zuhörer zogen die
Köpfe ein, tief zwischen die Schultern. Sie begriffen – es wurde unmöglich, nicht zu begreifen – dass sie nicht Gelächter hörten, sondern ein Schreien. Da war irgendwo ein Mensch, und dieser Mensch
brüllte.
Ilka betrachtete Matsue, der die Augen geschlossen hielt. Er sah wie ein alter Mann aus.
Das Schreien hörte auf. Die Erleichterung war unbeschreiblich, dauerte aber nur genauso unnatürlich lange wie der Augenblick, in dem ein heulendes Kind, endlich am Ende seiner Kräfte, aus einer
Quelle tief drin erneut Luft holt für eine weitere Heulattacke. Das Gebrüll setzte wieder ein, in einer Lautstärke, die in dem kleinen Hörsaal keinen Platz hatte; das menschliche Gehör war damit
überfordert. Die Anwesenden verspürten körperliche Bedrängnis. Sie pressten die Hände auf die Ohren.
Leslie hatte sich erhoben. „Ich schlage vor, wir stellen das Programm des heutigen Abends um und verlassen das Auditorium. Begeben Sie sich bitte alle ins Foyer und tun Sie sich an Wein und Käse
gütlich, bis wir dem Problem auf den Grund gegangen sind.“
Während sich der Saal leerte, lief Ilka rasch den Mittelgang entlang und sammelte die Spur von Zeitungsausschnitten auf, die Paulino dort hinterlassen hatte. Der junge Student, der neben ihm gesessen
war, fand den Umschlag und reichte ihn ihr.
Auf dem Weg zu Leslie Shakesperes Büro diagnostizierte Ilka an sich eine unangebrachte Aufregung darüber, dass es in ihrer Hand lag, Licht in die Angelegenheit zu bringen.
Ilka schaute in Leslies Büro. Paulino saß mit dem Rücken zur Tür auf einem ungepolsterten Stuhl und schüttelte heftig den Kopf. Leslie stand ihm gegenüber. Wie Ahmed und sämtliche Teilnehmer der
Diskussionsrunde, die sich in seinem Büro verteilt hatten, kniff er die Augen zusammen. Es sah aus, als wünschten sie, sie könnten jede ihrer Körperöffnungen verschließen, durch die gegen ihren
Willen Information eindrang. Die Zwischenwand dämmte zwar die Lautstärke ein wenig, konnte jedoch nichts gegen die Vielfalt – Tonhöhe, -länge oder –folge – der Laute ausrichten, die sich, wohl
aufgrund einer immer neuen, wechselnden Ursache dauernd änderten.
Leslie sagte: „Wir wissen, dass solche Dinge immerfort geschehen, ob wir die Opfer hören oder nicht. Aber das …“ Sein Blick fiel auf Ilka, die an der Tür stand: „Mr. Patillo ist doch in deinem
Sprachkurs, nicht? Er weigert sich, uns zu verraten, wie wir die Lärmquelle ausfindig machen können. Erst müsse sein Vater freigelassen werden.“
Ilka fragte: „Paulino? Paulino sagt, er ‚weigert sich’?“
Leslie sagte zu Paulino: „Würden Sie uns bitte mitteilen, wie wir die Lärmquelle finden, damit wir sie beseitigen können?“
Paulino schüttelte den Kopf. „Das ist mein Vater, der da schreit.“
Ilka folgte Leslies Blick. Maderiaga hockte mit hilfloser Grazie auf einer Ecke von Leslies Schreibtisch und sagte etwas Spanisches ins Telefon. Durch die geöffnete Tür sah Ilka in einen kleinen
Vorraum – ein weiteres Büro, in dem Shulamit Gershon eben den Hörer auflegte. Sie kam zurück und berichtete: „Patillo ist der Name, den der Vater dieses jungen Mannes von seiner bolivianischen
Ehefrau angenommen hat. Es handelt sich dabei um Klaus Herrmann, den Leiter des Statistischen Reichsamtes, der nach dem Anschluss nach Wien versetzt wurde, um eine Liste mit Namen und Adressen der
jüdischen Bevölkerung zusammenzustellen. Von dort kam er nach Budapest, und so weiter. Nach dem Krieg haben wir ihn in La Paz aufgespürt. Ich glaube, er geriet dann wegen irgendwelcher Minen oder
Waffengeschäfte in Schwierigkeiten. Wir haben uns auf andere Leute konzentriert, als sich herausstellte, dass die Bolivianer auch hinter ihm her waren.“
Maderiaga legte nun ebenfalls auf und sagte: „Der war aber ganz schön aktiv! Ich lasse überprüfen, ob es die Leute von Gonzales waren, weil er jemandem eine Zinnmine abspenstig gemacht hat, oder das
R.R.N. Wenn die den Verdacht hatten, dass Patillo etwas mit dem Hubschrauberabsturz zu tun hat, bei dem Präsident Barrientos ums Leben kam, dann ist er wohl so gut wie tot.“
„Das ist mein Vater, der da schreit“, sagte Paulino.
„Es hat nichts mit seinem Vater zu tun“, sagte Ilka. Als Matsue am Abend davor an der Tafel über das Prinzip der Umkehrwanze gesprochen hatte, war es Ilka völlig einleuchtend vorgekommen. Als sie es
Leslie nun erklärte, löste es sich in Nichts auf. Außerdem war sie abgelenkt von einem Bild, an das sie sich im Nachhinein erinnerte: Gestern Abend hatte Ilka, während sie den Gang entlanggehastet
war, den Kopf zur Seite gewandt, und da sie sich jetzt daran erinnerte, musste sie gesehen haben, wie Ahmed und Matsue gemeinsam den Korridor hinunter gegangen waren. Auch wenn Ilka die beiden für
ein seltsames Gespann gehalten hätte, so hätte sich der Gedanke aufgrund fehlender Verdachtsmomente ohnehin verflüchtigt, verdrängt von ihrem lebhaften Wunsch, Gerti und Paulino in den linken Lift zu
manövrieren, ehe die Türen sich schlossen, damit sie selbst mit dem rechten nach unten fahren konnte.
Jetzt fragte Ilka Ahmed: „Wo bist du gestern Abend nach der Stunde mit Matsue hin?“
Ahmed sagte: „Er wollte ins neue Auditorium.“
Darauf Leslie: „Ahmed, entschuldige bitte, dass ich dich den ganzen Abend herumkommandiere, aber könntest du bitte Matsue suchen gehen und ihn herbringen in mein Büro?“
„Er ist weg“, sagte Ahmed. „Ich hab ihn mit einem Koffer auf Rollen durch die Vordertür gehen sehen.“
„Er fährt nach Hause“, sagte Ilka. „Matsue hat seine Arbeit beendet.“
Paulino sagte: „Das ist mein Vater, der da schreit.“
„Nein, Paulino, das ist nicht dein Vater“, sagte Ilka. „Diese Schreie stammen aus Dachau und aus Hiroshima.“
„Das ist mein Vater“, sagte Paulino. „Und meine Mutter.“
Leslie bat Ilka, mit ihm zum Flughafen zu fahren. Matsue stand bereits in der Schlange vor der Gangway zu seinem Flugzeug, als sie ihn einholten. Vor ihm warteten fünf Passagiere.
Ilka sagte: „Matsue, du wirst doch nicht in das Flugzeug steigen, ohne uns zu sagen, wie man das Ding abschaltet?“
„Manna kannes nichtaabschalten.“
Ilka und Leslie sagten: „Wie bitte?“
Matsue vollführte mit der Hand, in der er nicht den Boardingpass hielt, eine Scharade – er tat, als würde er einen Wasserhahn zudrehen und schüttelte den Kopf. Ilka und Leslie verstanden: „Man kann
es nicht abschalten.“ Matsue machte einen Schritt auf Ilka zu, küsste sie auf die Wange, trat zurück und ging durch die Tür.
Wenn das Concordance Institute ein Problem angeht, dann möglichst menschlich. Leslie trieb die erforderlichen Mittel auf, um Paulino in einem privaten Sanatorium untersuchen zu lassen. Im neuen
Auditorium machten sich die Polizei, ein Bombenentschärfungsteam und eine private Akustikfirma aus Washington auf die Suche nach dem Ursprung der Schreie.
Leslie sah ausgezehrt aus. Seine Kollegen waren besorgt, als ihr Direktor, ein durchaus vernünftiger Mann, selbst dann noch das Mikrofon für den Lärm verantwortlich machte, als es bereits entfernt
worden war. Es schien sich nicht um ein immer wieder von vorne anfangendes Tonband zu handeln, bei dem sich die Hörer über kurz oder lang an ein bestimmtes Gebrüll oder Geschrei gewöhnen – sich
sozusagen damit anfreunden – hätten können; es ertönten ständig neue, unbekannte Schmerzensschreie.
Sowohl von der japanischen Botschaft in Washington als auch von der amerikanischen Botschaft in Tokio wurden Suchmeldungen versandt, um Matsue ausfindig zu machen, doch vergeblich.
Leslie rief einen Techniker zu Rate. „Schauen Sie in den Kabeln nach“, sagte er und sah in den in den Augen des Mannes jenen Blick, den ein Fachmann hat, wenn er einem Laien etwas erklärt und dieser
danach genau das, was er am Anfang gesagt hat, wiederholt. Der Fachmann startete einen neuen Versuch. Er erzählte Leslie von Schallwellen und ihrer Beschaffenheit; er sprach von transatlantischen
Telefongesprächen und elektrischen Gitarren. Leslie sagte: „Schauen Sie bitte mal in den Kabeln drin nach?“
Leslie feuerte das erste Akustik-Expertenteam, suchte eine andere Firma und bat diese, in den Kabeln nachzusehen. Der neue Fachmann meldete sich zurück mit dem Vorschlag, die Bühne des Auditoriums
auseinander zu nehmen. Wenn die Tontechniker eng mit den Leuten vom Abbruchunternehmen zusammenarbeiteten, bliebe der Rest des Saales hoffentlich unbeschädigt.
Inzwischen hatte Maderiagas Anruf am Abend des Symposiums eine ganze Reihe offizieller Vorgänge ausgelöst, infolge derer Paulinos Vater, Claudio Patillo, alias Klaus Herrmann, nach Concordance
gelangte. Der alte Mann war 89 und hatte durch Menschenhand ein Auge und durch Gottes Hand eine Lunge verloren. Im Flugzeug war er kollabiert, weshalb man ihn vom Flughafen direkt in die
Universitätsklinik von Concordance gebracht hatte.
Rabbi Grossman betrat Leslies Büro. „Ich höre wohl nicht richtig! Hast du tatsächlich einem Mann, der geholfen hat, österreichische und ungarische Juden zu ermorden, hier auf dem Campus eine
Unterkunft zur Verfügung gestellt?“
„Und eine private Krankenschwester.“
„Hast du den Verstand verloren?“ fragte Rabbi Grossmann.
„Mehr oder weniger, ja.“
„Du siehst fürchterlich aus“, sagte Shlomo Grossman und setzte sich.
„Was in drei Teufels Namen soll ich mit einem alten Nazi machen, der gerade erst operiert wurde, dessen Sohn in der Nervenheilanstalt sitzt, der keine Menschenseele kennt, und der keinen Pfennig und
kein Dach über dem Kopf hat?“
„Schick ihn heim nach Deutschland!“ rief Shlomo.
„Wollte ich ja. Dobelmann behauptet, da wird Claudio Patillo nicht als Staatsbürger anerkannt.“
„Dann schick ihn nach Israel, damit er seine gerechte Strafe bekommt!“
„Shulamit sagt, die Israelis seien nicht mehr interessiert, Shlomo! Die haben ganz andere Fische an der Angel!“
„Setz ihn wieder ins Flugzeug und schick ihn zurück, wo er hergekommen ist.“
„Damit das Geschrei wieder losgeht? Shlomo!“ Leslie presste die Hände auf die Ohren, um sie vor dem Lärm zu schützen, der aus dem Haufen auseinandergenommener Bauteile hinter dem Institut
hereindrang, sich im Umkreis von Kilometern über die Landschaft breitete, sich in jede einzelne Straße, jeden Garten der kleinen Universitätsstadt ergoss und auch vor Leslies geschlossenen Fenstern
und Fensterläden nicht halt machte. „Shlomo“, sagte Leslie, „Komm heute Abend zu uns. Ich verspreche dir, Eliza wird etwas kochen, das du essen kannst. Ich brauche dich, und Ilka, und vielleicht noch
ein paar andere, damit wir gemeinsam überlegen können, wie wir die Sache angehen.“
„Uns … mir muss klar werden“, begann Leslie am selben Abend „inwiefern das Schreien aus Dachau dasselbe ist wie das Schreien aus Hiroshima, und inwiefern sich die beiden unterscheiden. Und außerdem
muss mir klar werden, wie man das genau gleich klingende Schreien erträgt, das aus jener Hölle erklingt, in der der Folterknecht kriegt, was er verdient…”
Seine Frau rief: „Leslie, kommst du bitte mal, Ahmed möchte dich sprechen."
Leslie ging hinaus und kam gleich darauf mit seinem Mantel über dem Arm zurück. Ein paar junge Punks, waren in Patillos/Herrmanns neues amerikanisches Haus eingebrochen. Sie hatten die
Krankenschwester gefesselt und geknebelt und zusammen mit dem ebenfalls gefesselten Klaus in ihrem neuen amerikanischen Badezimmer eingesperrt. Ilka begann zu lachen. Leslie knöpfte den Mantel zu und
sagte: „Tut mir leid, ich muss rüber. Ilka, Shlomo, morgen früh fahre ich nach Washington und treffe mich mit den Leuten vom Superfund. Wenn ich schon da bin, werde ich gleich um die nötigen
Zuschüsse für ein Anti-Schrei-Projekt ansuchen. Ilka? Ilka, was ist los?“ Aber Ilka lachte haltlos und war nicht imstande, zu antworten. Leslie sagte: „Ich möchte, dass ihr zwei euch hier und jetzt
hinsetzt und euch eine Formulierung überlegt, mit der ich morgen vor die Abteilung Arts and Humanities treten kann.“
Das Institut erhielt vom Superfund-Altlastenentsorgungsprogramm einen Zuschuss zur Lärmbeseitigung, und die ausgebaute Bühne des neuen Auditoriums wurde auf einen Tieflader gehievt und westwärts
gekarrt. Die Bevölkerung entlang der Route 90 bis hinunter nach Arizona kam mit zusammengekniffenen Augen und eingezogenen Köpfen auf die Straße. Man vergrub das Ding fünfzehn Fuß unter der
Erde, in ausreichender Entfernung vom Highway, und ließ die Wüste heulen.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags
