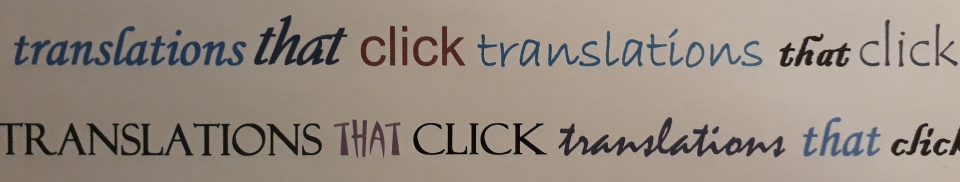
Der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten
in ihren unübersetzbaren Worten.
Marie v. Ebner-Eschenbach
Leseprobe
aus: Gill Sims „Mami will auch mal - Tagebuch einer entfesselten Mutter“ (Eisele, 2021)
Beinahe achtzehn Jahre lang war ich über jedes einzelne Detail
im Leben meiner Sprösslinge informiert. Ich musste mir ihr
endloses Gequassel anhören (»Und dann hat Lea zu Lara gesagt
… und Sophie hat gesagt … nein, nicht die Leah, Mami, die
Lea ohne h …«), wurde nach meinem Lieblings-Pokémon gefragt
und dann darüber aufgeklärt, warum die anderen alle viel
besser seien, und dachte in dieser Zeit unzählige Male: Herrgott
noch mal, nun haltet doch endlich mal fünf Minuten den
Schnabel! Und siehe da, eines Tages tun sie genau das! Es ist ein
Wunder! Aber auch ein bisschen seltsam.
Ich befinde mich dieser Tage in einem merkwürdigen Zwischenstadium:
Sie brauchen mich noch, aber nicht mehr so
dringend wie früher. In meinen vier Wänden wimmelt es nach
wie vor regelmäßig von lärmenden, müffelnden, gefräßigen
Wesen, aber ich darf nichts über sie wissen, weder was sie treiben,
noch wo sie hingehen, noch warum sie fünfzehn leere
Chipstüten auf dem Deckel des Abfalleimers gestapelt haben,
als hätten sie eine Art Müll-Jenga gespielt. Ich bin immer noch
ihre Mutter, aber in vielerlei Hinsicht sind sie mir fremd geworden.
Ich weiß absolut alles über sie, und zugleich habe ich keine
Ahnung, wer sie sind. Was zum Teil daran liegt, dass sie selbst
nicht wissen, wer sie sind, das ist mir klar. Sie befinden sich in
einer Übergangsphase – hinter sich das Kind, das sie waren, vor
sich der Erwachsene, der sie einmal sein werden. Ein schwacher
Trost.
Ganz schön verwirrend, das alles. So wollte ich das eigentlich
nicht haben. Ich wollte bloß, dass sie aufhören, mir die Ohren
vollzulabern, dass sie ihr Gemüse essen, ohne einen Aufstand
zu machen, dass sie mich in Ruhe aufs Klo gehen lassen und lernen,
wie man einen anständigen Gin Tonic mixt. Als sie noch
klein waren, dachte ich allen Ernstes, es würde sich nie etwas
ändern. Damals fühlte es sich so an, als würde alles so bleiben,
wie es war. Jeder Tag zog sich schier endlos hin, nichts als Duplosteine
und Gebrüll und vollgekackten Windeln, dazu diese total beknackten
Teletubbies und die allabendliche Gutenachtgeschichte,
und kein Ende in Sicht.
Aber jetzt ist es auf einmal doch da,
das Ende dieser Ära, und ich muss sagen, ich trauere ihr kein
bisschen nach, obwohl mir genau das unzählige Male prophezeit
wurde. Wann immer ich einen schlechten Tag hatte, tauchte
wie aus dem Nichts eine dieser oberschlauen alten Schabracken
auf und riet mir, diese Zeit auszukosten, denn sie sei ja so
schnell vorüber. Ich weiß noch, wie mir Peter einmal während
eines Einkaufs bei Tesco ins Dekolleté reiherte, während Jane
einen Tobsuchtsanfall bekam, weil ich sie daran gehindert hatte,
eine Flasche Tequila aufzuschrauben und daraus zu trinken,
und als ich in Tränen ausbrach und heulte: »Oh Gott, es reicht,
ich kann nicht mehr! Ich hasse mein Leben!«, tätschelte mir
doch glatt eine dieser rüstigen Rentnerinnen den Arm und zwitscherte:
»Genießen Sie jeden Tag, solange die beiden noch klein
sind – Sie werden später einmal wehmütig daran zurückdenken.«
Ich überlegte in dem Moment ernsthaft, ob ich ihr eins
mit der Flasche überziehen sollte, die ich Jane gerade abgenommen
hatte, oder ob ich mir lieber an Ort und Stelle ein paar kräftige
Schlucke Tequila gönnen sollte.
Nein, diese Zeit fehlt mir ganz und gar nicht.
Nicht ein einziges Mal habe ich in den vergangenen
Jahren in einem Supermarkt gestanden und betrübt
bei mir gedacht: Ach, wie schön wäre es doch, wenn mir eine
meiner beiden Pestzecken auf Schritt und Tritt nachlaufen und
»Mami, ich will … Mami, kann ich … Mami, darf ich … Mami,
warum nicht?« nölen würde, während das zweite Kind versucht, sich
beim Sturz aus dem Einkaufswagen den Schädel zu spalten, sodass
wir schnurstracks in die Notaufnahme fahren müssen.
Ich sehne mich weder danach, mal wieder jemandem den Allerwertesten
abzuwischen, noch trauere ich den ach-so-glücklichen
Tagen nach, als sämtliche Oberflächen in unserem Zuhause
mit Glitzer und Kleber verkrustet waren, als hätte ein
hyperaktives, inkontinentes Einhorn dort gewütet. Aber es ist
schon etwas gewöhnungsbedürftig, dass Peter und Jane meine
Existenz kaum noch zur Kenntnis nehmen, nachdem ich für
sie so lange der Nabel der Welt war, die zentrale Anlaufstelle für
das Verarzten von Blessuren und das Trocknen von Tränen, für
Geborgenheit, Bespaßung und Wissensvermittlung. Natürlich
brauchen sie mich auch jetzt noch gelegentlich, etwa, wenn
Peter mal wieder den Käse im Kühlschrank sucht, obwohl er direkt
vor seiner Nase liegt. Oder wenn Jane den letzten Bus aus
der Stadt verpasst hat. Dann soll sich Mami am liebsten zu ihr
beamen und sie stante pede nach Hause bringen. Wann immer
es regnet und sie irgendwo hinmüssen, wann immer sie Geld
brauchen, fällt ihnen wieder die Frau ein, die ihnen das Leben
geschenkt, ihnen all ihre kindlichen Wünsche erfüllt und aufopferungsvoll
dafür gesorgt hat, dass sie glücklich und wohlauf
sind. Meistens, wenn ich bereits etwas vorhabe.
Und man stelle sich vor, gelegentlich bedanken sie sich sogar!
Allerdings nicht allzu oft. Meist betrachten sie meine
Dienste als völlig selbstverständlich und verbieten mir, in der
Gegenwart ihrer Freunde das Wort an sie zu richten, weil ihnen
schon meine bloße Existenz so unfassbar peinlich ist. Ich revanchiere
mich dann, indem ich sie vor besagten Freunden unüberhörbar
mit »Schnuckilein« und »Hasenpups« anrede und ihnen
wortreich versichere, dass Mami sie ganz schrecklich liebhat.
Es muss schließlich irgendeine Art von Entschädigung dafür
geben, dass ich Mutter bin. Ist man überhaupt eine richtige
Mutter, wenn man seine Sprösslinge nicht dann und wann bewusst
und in böswilliger Absicht vor ihren Freunden blamiert?
Vor einer Weile kam ich auf folgende geniale Idee: Ich drohte
damit, keinen BH zu tragen, wann immer ihre Freunde zu Besuch
waren, sollten sie nicht häufiger ihre Zimmer aufräumen
und mehr im Haushalt mithelfen. Hach, das war eine herrliche
Woche. Bis ihnen klar wurde, dass ich meine Drohung niemals
wahr machen würde, weil es mir mindestens ebenso peinlich
wäre wie ihnen, vor einem Trupp Teenager mit frei schwingenden
Pampelmusen in der Bluse durchs Haus zu stolzieren. Von
da an machten sie wieder Dienst nach Vorschrift. Dafür war
Janes Empörung groß, als ich eines Tages vor ihren Freundinnen
kundtat, ich sei keine normale Mum, sondern eine coole
Mum. Das war eine der Sternstunden meines Mutterdaseins.
Ach, was habe ich gelacht, während mein Töchterlein vor Wut
schäumte!
So viele Jahre dachte ich: Ach, wenn ich doch nur Zeit für dieses
oder jenes hätte, ein bisschen Zeit für mich … Tja, allmählich
zeichnet sich ab, dass ich schon sehr bald sehr viel Zeit für
mich haben werde. Ich fürchte nur, nachdem ich mich so lange
damit abgemüht habe, alles unter einen Hut zu bringen, nachdem
ich mir angewöhnt habe, ständig Multitasking zu betreiben
und alles in übermenschlichem Tempo zu erledigen, werde
ich nichts anzufangen wissen mit dieser vielen mir zur Verfügung
stehenden Zeit. Womöglich bin ich dann gezwungen,
mich zu fragen, wer ich inzwischen eigentlich bin. Was ist,
wenn mir die Antwort nicht gefällt? Was ist, wenn ich feststelle,
dass ich eine trantütige Trine mittleren Alters geworden bin,
die immer nur für ihre Kinder da war und jetzt, wo die lieben
Kleinen flügge sind, kann sie in Ermangelung eigener Interessen
nicht aufhören, sich in ihr Leben einzumischen? Was ist,
wenn ich über keine inneren Ressourcen verfüge, sei es, weil ich
nie welche hatte, sei es, weil sie mir abhandengekommen sind?
Eine der zahlreichen Geldverschleuderungsmaßnahmen, die
sich die Chefetage unserer Firma regelmäßig einfallen lässt, bestand
darin, eine externe Beraterin einzuladen, mit der alle Angestellten
ein Gespräch führen sollen. Auf diese Weise sollte
wohl überprüft werden, ob wir auch normal und fit im Ober-
stübchen sind oder ob einer von uns vorhat, mit einer Tackerpistole
Amok zu laufen. Im Zuge unserer »kleinen Unterhaltung«
bat mich besagte Beraterin, zehn Dinge zu nennen, die
ich gerne täte, einfach für mich.
Ich grunzte belustigt. »Nur zehn? Das wird schwierig. Also,
ich würde in Ruhe ein Bad nehmen. Ich würde den ganzen Nachmittag
lesen, ohne ständig von meinen Kindern unterbrochen
zu werden, weder persönlich noch per SMS, sollten sie bei ihrem
Vater sind. Ich würde … Hm … Ich würde …«
»Lassen Sie sich Zeit«, sagte die Beraterin freundlich.
»Jaja. Ich kann mich bloß nicht entscheiden … Also, ich …
Tja, ich weiß auch nicht. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was
ich sonst noch tun würde!«
Die Beraterin versicherte mir, das sei normal; die meisten
Menschen fänden es viel schwieriger als angenommen, eine solche
Liste zu erstellen. Sie trug mir auf, darüber nachzudenken
und mir mehr Zeit für mich selbst zu nehmen, um »ein bisschen
runterzukommen«. Natürlich habe ich das Problem danach
sofort verdrängt und nicht wieder darüber nachgedacht.
Aber vielleicht ist es nun doch mal an der Zeit, mir zu überlegen,
was ich alles machen würde, wenn ich die nötige Zeit dafür
hätte. Hm. Eine Kreuzfahrt auf dem Nil vielleicht (wobei ich
sehr enttäuscht wäre, wenn kein Mord geschähe). Oder einen
Reiturlaub … ich sah mich flüchtig durch die Wüste nach Petra
galoppieren, wie in einem Prospekt, den ich mal irgendwo gesehen
hatte, dann fiel mir wieder ein, dass ich nicht reiten kann
und Angst vor Pferden habe.
All das ging mir durch den Kopf, während ich vergeblich versuchte,
die Wohnzimmermöbel so zu verschieben, dass die Flecken,
die Klein Edwards schwarzer Johannisbeersaft auf dem Teppich
hinterlassen hatte (das Zeug ist leider deutlich hartnäckiger als
Rotwein), nicht mehr zu sehen waren. Ich rief mir in Erinnerung,
dass es im Moment noch ein richtiger Glücksfall war,
wenn ich mal einen Samstagabend für mich hatte. Jane hatte
mich nämlich vorhin per SMS informiert, sie gedenke bei Olivia
zu übernachten. Ich unterdrückte den Impuls, Olivias Mutter
anzurufen und mich zu erkundigen, ob meine Tochter auch
tatsächlich dort war. Jane ist fast achtzehn, sagte ich mir. Dir
bleibt gar nichts anderes übrig, als ihr zu glauben, denn wenn
du ihr nicht vertraust, erzählt sie dir künftig garantiert gar
nichts mehr. Und überhaupt geht sie schon bald auf die Uni,
und dann hast du ohnehin keine Ahnung, was in ihrem Leben
vor sich geht, es sei denn, sie berichtet dir davon. Ich schickte
ein kurzes Stoßgebet gen Himmel, auf dass sie bis dahin nicht
schwanger oder drogenabhängig wurde. Ich meine, natürlich
wäre es mir lieb, wenn sie auch später keine Drogen nähme,
aber bitte, bitte nicht schon bevor sie anfängt zu studieren. Sofern
sie es überhaupt an die Universität schafft. Alles steht und
fällt damit, dass sie ihre Reifeprüfung gut hinter sich bringt,
und in der Hinsicht verhält sie sich nach wie vor äußerst gleichgültig
und knurrt die ganze Zeit bloß »Chill mal, Mutter!«,
wann immer ich vorsichtig andeute, dass es möglicherweise angebracht
sein könnte, etwas mehr zu lernen und etwas weniger
Party zu machen.
Schließlich machte ich es mir mit dem ersten Glas Weißwein
und der Tüte Chips auf dem Sofa gemütlich und fragte mich,
wie viele Folgen von The Witcher ich mir zu meinem gesunden,
nährstoffreichen Dinner for One reinziehen konnte, ehe ich eindöste.
Und wie oft Henry Cavill wohl im Adamskostüm zu sehen
sein würde. Angeblich ist es verwerflich, sich so etwas zu
fragen, weil man die Männer dadurch zum Sexobjekt degradiert.
Aus denselben Gründen ist es auch verwerflich, Henry
Cavill als »Hottie« zu bezeichnen. Wie es scheint, mögen Männer
es nicht, wenn man sie zum Sexobjekt degradiert. Jedenfalls
habe ich das in einem Interview mit Aidan Turner alias »Oben-
Ohne-Captain Poldark« gelesen. Allerdings finde ich, ich habe
verdammt noch mal ein Recht darauf, halbnackte Männer im
Fernsehen anzuschmachten, nachdem ich es mir jahrzehntelang
gefallen lassen musste, dass irgendwelche Wichser bei
meinem Anblick »Heiße Titten, Herzchen!« johlten, gerne gepaart
mit der Aufforderung, ihnen doch ein Lächeln zu schenken.
Ja, man könnte mir vorwerfen, dass ich mit zweierlei Maß
messe, aber ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, jetzt müssen es
zur Abwechslung mal die Männer aushalten, zu Sexobjekten
degradiert und lüstern grinsend beäugt zu werden. Kampf dem
Patriarchat! Wenn wir in ein paar tausend Jahren dann quitt
sind, können wir uns meinetwegen darauf einigen, dass kein
menschliches Wesen auf seine ausgesprochen muskulöse Brust
oder sein überaus beeindruckendes Schwert reduziert werden
sollte.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags
